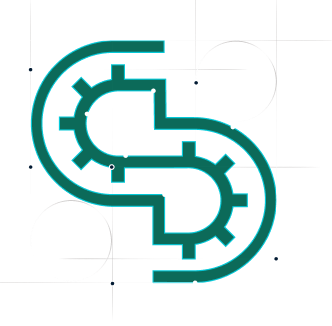Conrad Greer & nachhaltige Strukturen für Ersatzteildaten (Teil 3)
In unserer vertieften Diskussion mit dem Ersatzteilmanagement-Experten Conrad Greer wechseln wir nun von der Strategie zur praktischen Umsetzung. In Teil 1 haben wir untersucht, wie inkonsistente Artikelidentitäten selbst die leistungsfähigsten ERP-Systeme beeinträchtigen können – mit erheblichen betrieblichen Ineffizienzen, Sicherheitsrisiken und organisatorischen Silos. In Teil 2 haben wir gezeigt, wie schlechte MRO-Daten funktionsübergreifende Leistung und finanzielle Ergebnisse beeinflussen und wie sich die Kosten minderwertiger Daten quantifizieren lassen.
In diesem dritten Teil konzentrieren wir uns darauf, wie Unternehmen historische MRO-Daten in einen sauberen, rationalisierten Ersatzteilkatalog überführen können. Greer stellt praxisnahe Methoden vor, um strukturierte Taxonomien anzuwenden, Datenkonsistenz sicherzustellen und skalierbare Governance-Prozesse aufzubauen, die sich an die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen.
Von Datensilos zum sauberen Katalog
In seiner Beratungstätigkeit arbeitet Greer remote mit großen Unternehmen an der Bewertung und Rationalisierung ihrer MRO-Daten. Der erste Schritt umfasst das Sammeln relevanter Systemdaten – etwa Bestandsaufzeichnungen oder Instandhaltungsprotokolle – bevor eine strukturierte Analyse durchgeführt wird, um Ineffizienzen im Ersatzteilmanagement sichtbar zu machen.
„Es geht nicht nur darum zu sagen: Das tut weh. Wir erzählen die Geschichte mit echten Daten und machen so Verbesserungsmöglichkeiten klar und umsetzbar.“
Diese Diagnosephase zeigt nicht nur das Business Case für MRO-Datenverbesserungen, sondern definiert auch die nächsten Schritte in Bezug auf Taxonomie, Standardausrichtung und Katalogbereinigung.
Taxonomien anwenden, um Ersatzteildaten nutzbar zu machen
Greer setzt auf strukturierte MRO-Taxonomien – Klassifikationsrahmen, die konsistente und durchsuchbare Artikelstammdaten ermöglichen. Nachdem die Rohdaten gesammelt wurden, lädt sein Team sie in eine Taxonomie-Engine, um die Rationalisierung zu starten. Dies umfasst das Identifizieren von Duplikaten, das Harmonisieren inkonsistenter Beschreibungen und das Abgleichen technischer Spezifikationen mit standardisierten Feldern.
„Es geht nicht nur darum, Herstellerteilenummern zu vergleichen. Wir standardisieren Merkmalsfelder innerhalb der Materialklassen, damit Beschreibungen vergleichbar sind. Das ist der Schlüssel zur Differenzierung.“
Standards allein reichen nicht – Nutzerorientierung ist entscheidend
Rahmenwerke wie UNSPSC, ISO 8000 oder ISO 22745 sind sinnvolle Ausgangspunkte, aber Greer betont, dass sie nicht dafür ausgelegt sind, Instandhaltungsplanern schnell die richtigen Teile zu liefern.
„UNSPSC ist nur ein Gruppierungswerkzeug. Es hilft niemandem im Feld, das wirklich benötigte Teil zu identifizieren.“
Sein Ansatz besteht darin, kundenspezifische Taxonomien zu entwickeln – zugeschnitten auf die jeweiligen Anlagen und Betriebsumgebungen. Die Kunden validieren diese Taxonomien aktiv, um deren praktische Anwendbarkeit sicherzustellen. Zur Skalierung setzt sein Team externe Ressourcen ein, um Datensätze zu kodifizieren und anzureichern. Häufig zeigt sich: Bei Artikeln mit fünf wesentlichen Attributen fehlen in bis zu 75 % der Datensätze zwei oder mehr Angaben.
Umgang mit obsoleten und unbestimmten Artikeln
Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Identifikation veralteter oder unbestimmter Artikel. Ersatzteile ohne aktuelle Nutzung und ohne Bestand werden zur Löschung markiert. Existiert noch Lagerbestand, wird der Artikel für eine Prüfung vorgemerkt.
„Obsolete Teile sind Ballast. Sie belegen Platz, verwirren Anwender und liefern keinen betrieblichen Mehrwert.“
Allerdings sollte das Entfernen obsoleter Artikel nicht der erste Schwerpunkt sein. Vorrang hat der Aufbau eines rationalisierten, verlässlichen Katalogs.
Das Ziel: Ein sauberer, nutzbarer MRO-Katalog
Greers Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, einen sauberen, präzisen und anwenderfreundlichen MRO-Ersatzteilkatalog aufzubauen – als Basis für Beschaffung, Lagerverwaltung und Instandhaltungsplanung.
„Das Ziel ist einfach: ein Artikel für jeden tatsächlichen Instandhaltungsbedarf – nicht mehr und nicht weniger.“
Durch die Kombination aus strukturierter Taxonomie, relevanten Standards und Validierung durch Fachanwender wird aus Ersatzteildaten ein strategisches Asset.
Taxonomie auch für zukünftige Änderungen anwenden
Ist der Katalog erst einmal rationalisiert, erfordert seine Integrität konsequente Governance. Greer empfiehlt, dieselbe Taxonomie auf alle neuen Dateneinträge anzuwenden.
„Der Schlüssel ist, dieselbe Taxonomie zu verwenden, die bei der Rationalisierung angewendet wurde – für jeden neuen Eintrag.“
Ob Übernahme, Großprojekt oder neues Material: Jeder neue Artikel muss der bestehenden MRO-Taxonomie entsprechen. So entstehen konsistente Daten über den gesamten Anlagenlebenszyklus, Dubletten werden vermieden und Vergleichbarkeit gesichert.
Die alltägliche Quelle für Katalogvermüllung
Greer betont, dass nicht Großprojekte, sondern der tägliche Betrieb die Hauptquelle für Katalogverunreinigungen ist. Neue Materialanforderungen aus dem operativen Bereich umgehen häufig formale Prüfprozesse.
„Wir sehen Unternehmen, die ohne größere Projekte Tausende neuer Artikel anlegen. Sie wachsen nicht – sie duplizieren.“
In vielen Bereichen gelten strenge Änderungsprozesse – nur nicht bei Ersatzteilen:
„In den meisten Bereichen braucht jede Änderung eine Prüfung und Freigabe. Bei MRO-Artikeln heißt es aber oft: Neues Teil? Einfach anlegen. Der Herstellerteilenummer-Check reicht nicht.“
Governance mit Flexibilität: Eine lebendige Taxonomie
Standardisierung ist essenziell, doch Greer plädiert für einen flexiblen Ansatz, der sich mit den operativen Anforderungen weiterentwickelt. Mitarbeitende im Feld sollten Verbesserungen vorschlagen können; Änderungen an der Taxonomie müssen jedoch strukturiert und begründet erfolgen.
„Die Taxonomie ist nicht statisch. Sie sollte sich mit dem Unternehmen weiterentwickeln. Gute Governance schafft Konsistenz und ermöglicht gleichzeitig kontinuierliche Verbesserung.“
Ein rationalisierter Katalog ist kein starres Verzeichnis, sondern ein dynamisches Rahmenwerk, das durch klare Governance, kontrollierte Dateneingabe und Flexibilität optimale Effizienz unterstützt.
Fazit: Vom Aufräumen zur kontinuierlichen Steuerung
Wie Greer betont, ist Ersatzteildatenmanagement ein fortlaufender Prozess. Durch strukturierte Taxonomien, die konsequente Ausrichtung neuer Einträge auf bestehende Standards und das Einbinden operativer Rückmeldungen können Unternehmen Kataloge schaffen, die sich mit ihren Anforderungen weiterentwickeln. Lösungen wie SPARROW.Clean unterstützen diesen Weg, indem sie Ersatzteildaten systematisch bereinigen und harmonisieren – als Grundlage langfristiger Datenintegrität.
Das Ziel ist nicht nur, Daten zu bereinigen, sondern ein System aufzubauen, das zukünftige Katalogverunreinigungen verhindert, bessere Entscheidungen unterstützt und die Zusammenarbeit zwischen Instandhaltung, Supply Chain und Beschaffung stärkt.
Demnächst in Teil 4: Wie künstliche Intelligenz und Machine Learning das Ersatzteilmanagement verändern – von automatischer Klassifizierung bis zur vorausschauenden Bestandsplanung.
Teil 1 verpasst? Conrad Greer & die Risiken fehlerhafter Ersatzteildaten
Teil 2 verpasst? Conrad Greer & die wahren Kosten schlechter Daten